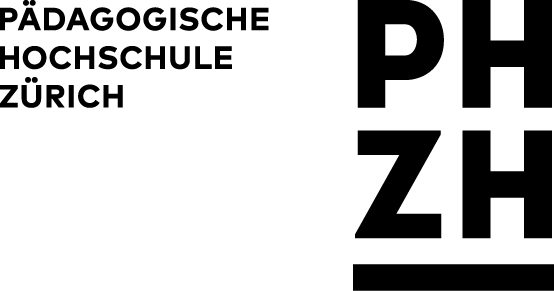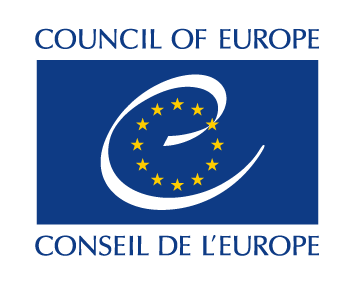2 – Material 2: Weshalb es mit Frontalunterricht nicht getan ist oder „gelehrt ≠ gelernt” und „gelernt ≠ angewendet im wirklichen Leben”
Living Democracy » Textbooks » 2 – Material 2: Weshalb es mit Frontalunterricht nicht getan ist oder „gelehrt ≠ gelernt” und „gelernt ≠ angewendet im wirklichen Leben”Lehrpersonen mit einer eher traditionellen Ausbildung neigen dazu, die Auswirkung der mündlichen Instruktion auf die Lernenden zu überschätzen, d.h. „gelehrt ist gelernt”. Diese Sichtweise (Lehr-Lern-Kurzschluss) ist insbesondere unter Lehrpersonen in der Sekundarstufe verbreitet, denen die Stofffülle des Lehrplans und die Komplexität der Inhalte zu schaffen macht. Die Lehrpersonen sind dann versucht, den scheinbar schnellsten und effektivsten Weg der Stoffvermittlung zu gehen: die Lehrperson doziert und die Lernenden hören zu. Eine Lehrperson in Geschichte kann dann sagen: „Nun habe ich das 19. Jahrhundert behandelt.“
Aber lernen die Schülerinnen und Schüler, wenn sie Vorträgen zuhören? Und haben alle tatsächlich auch das gelernt, was die Lehrperson sich vorgestellt hatte?
„Gelehrt ≠ gelernt”
Aus einer konstruktivistischen Perspektive lautet die Antwort: nein, gelehrt ist nicht gleich gelernt. Lernen ist ein individueller Prozess. Die Lernenden konstruieren buchstäblich ihre individuellen Wissenssysteme. Dabei verknüpfen sie ihre Vorkenntnisse und Einsichten mit neuen Informationen, indem sie z.B. diese mit Konzepten verknüpfen, neue Ideen entwickeln oder sich in ihrer Urteilsbildung auf ihre Erfahrungen stützen. Sie suchen nach dem Sinn und die Logik in den neuen Inhalten, und sie bestimmen jeweils, was für sie relevant ist und sie sich merken wollen und womit sie ihr Gedächtnis nicht belasten werden.
Und sie machen auch Fehler.
Eine Lehrperson, die vor 30 Lernenden einen Lehrervortrag hält, sollte sich deshalb bewusst sein, dass in den Köpfen der Lernenden 30 Versionen des Vortrags produziert und in das je eigene Bedeutungssystem integriert werden. Es entstehen 30 unterschiedliche „kognitive Strukturen“ (Jerome Bruner).
Doch beim Lernen geht es nicht nur um die Konstruktion von Bedeutung, sondern auch um die Dekonstruktion von Irrtümern. So mögen junge Schulkinder unter Umständen glauben, dass es Nacht wird, weil die Sonne sich hinter dem Horizont schlafenlegt. Eine Lehrperson handelt sicher angemessen, wenn sie versucht, diese Vorstellung zu korrigieren. Sie verlangt von den Kindern, ihre bisherigen Vorstellungen zu dekonstruieren und neu auszurichten, und die Kinder könnten ganz unterschiedlich darauf reagieren. Der Vortrag der Lehrperson mag für ein Kind eine neue Sicht auf die Welt eröffnen, während sich anderes sich gegen die Entzauberung seiner Ideen wehrt.
Aus einer konstruktivistischen Sicht müssen wir daher davon ausgehen, dass Brüche in der Logik, Denkfehler und Missverständnisse eher die Regel als die Ausnahme sind – nicht nur in den Köpfen unserer Lernenden, sondern auch bei uns selbst.
Die Korrektur unserer kognitiven Strukturen ist daher komplexer als der einfache Austausch „alten Wissens“ gegen „neues Wissen“, wie es eine Lehrperson mit der „Vermittlung von Stoff“ versucht. Bei der Weiterentwicklung kognitiver Strukturen handelt es sich um einen kontinuierlichen Lernprozess über einen längeren Zeitraum hinweg. Einander widersprechende Vorstellungen konkurrieren miteinander konkurrieren – und die Lernenden müssen die Dekonstruktion leisten, nicht die Lehrperson.
Lehrpersonen können Lernprozesse unterstützen, aber nicht steuern.
„Gelernt ≠ angewendet im wirklichen Leben”
Lehrpersonen, die versuchen, Fehler der Lernenden zu korrigieren, stellen oft fest, dass es nicht ausreicht, den Lernenden schlicht zu belehren, was „richtig” ist. Lehrperson sehen sich mit den folgenden Problemen konfrontiert:
- Die Lernenden scheinen nicht zuzuhören: Wie gehe ich mit dem Problem um, dass Lernende ihre falschen Vorstellungen oft auch dann nicht ändern, wenn ich ihnen die richtigen Fakten, Konzepte usw. vermittelt habe?
- „Schüler lernen wie Papageien”: Wie gehe ich mit dem Problem um, dass Schulwissen in den Köpfen der Lernenden unvermittelt mit anderen Wissensformen koexistiert? Das können kindliche Denkmuster sein, mit denen Denkfehler, logische Brüche, Fehlinformationen und Fehlurteile eingehen, oder Alltags- und Lebenserfahrung. Die Lernenden scheinen sie ihr Schulwissen „wie Papageien” auf die nächste Prüfung hin auswendig zu lernen, um es dann gleich wieder zu vergessen.
- Das sind Probleme, die jede Lehrperson bestens kennt, und die auch konstruktivistisches Lernen nicht überwinden kann. Vielmehr müssen die Lernenden mit dem Gelernten etwas anfangen können – sie müssen es anwenden und seinen Nutzen erfahren. Dies bedeutet für die Lehrperson beispielsweise:
- kein Lehrervortrag ohne eine Anschluss-Aufgabe, die der Verarbeitung und dem Transfer dient (Wechsel von Instruktion, Konstruktion bzw. Dekonstruktion und Transfer mit Reflexion);
- die Beiträge und Leistungen der Lernenden diagnostizieren, um ihren – individuellen –Lernfortschritt, ihr Kompetenzniveau und ihre Lernbedürfnisse zu erkennen;
- den Lernenden die Verantwortung für die eigene Entwicklung übertragen, z. B. in handlungsorientierten Lernangeboten;
- auf das Feedback der Lernenden einholen: „Was ich besonders wichtig fand, war …”, „Ich lerne am besten, wenn …”.
Die Aufgabe der Lehrperson liegt darin, den Lernenden angemessene Lernmöglichkeiten zu bieten und mit ihnen gemeinsam zu beurteilen und zu besprechen, was im Unterricht gut funktioniert und was nicht. Konstruktivistisches Lernen, Dekonstruktion und Transferaufgaben benötigen Zeit. Und da Zeit eine knappe Ressource ist, muss die Lehrperson entscheiden, welche Themen exemplarisch vertieft werden sollen. An solchen Entscheidungen nach dem Prinzip „Mut zur Lücke” sollten möglichst die Lernenden beteiligt werden, zumindest aber sollte die Lehrperson ihnen ihre Entscheidung transparent machen.
65. Vgl. dazu „Eine demokratische Atmosphäre in der Klasse schaffen“ https://www.living-democracy.com/de/textbooks/volume-1/part-2/unit-1/chapter-2/lesson-7/